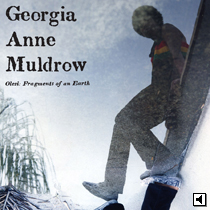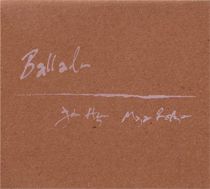Erst wurde „Love“ von Foetus falsch gepresst, dann ging diese Platte unter. Im Laden ist sie nur schwer zu finden – höchste Zeit, sie zu entdecken
Im Spätsommer 2005 veröffentlicht Foetus das Album Love. Es gibt die üblichen Besprechungen in Musikmagazinen. Kaum stehen die ersten Exemplare in den Läden, stellt sich heraus, dass dem Presswerk ein Fehler unterlaufen ist. Statt des Albums war eine Vorabsingle mit vier Stücken vervielfältigt worden. Man ruft die gesamte Auflage zurück. In der Flut von Neuveröffentlichungen geht es unter, dass das Album einige Zeit später erneut veröffentlicht wird – dieses Mal korrekt gepresst.
So ist wohl auch zu erklären, dass Love in kaum einem Plattenladen zu finden ist. Denn vollkommen unbekannter ist der Mann, der sich mit dem Künstlernamen Foetus schmückt, nicht. Seit Anfang der Achtziger macht der Australier James George Thirlwell Musik und hat seitdem etliche Bewunderern gefunden.
Mit 18 kam er nach Europa und begann seine musikalische Karriere im Umfeld der Einstürzenden Neubauten. Er entwarf düstere Klangvisionen und veröffentlichte seine Produktionen unter unzähligen Projektnamen. Nebenbei agierte er als Remixer für die Nine Inch Nails und die Red Hot Chili Peppers. Zudem trieb er unter dem Namen Clint Ruin allerhand Schweinkram in den erotischen Kunstfilmen Richard Kerns.
Foetus’ Musik basiert auf Samples und erinnert an Filmmusik. Love ist mutig instrumentiert. Harfen treffen auf schmetternde E-Gitarren, das Waldhorn wird vom Theremin gezähmt. Das Thema des Spinetts scheint sich durch die ganze Platte zu ziehen. Hat Ennio Morricone nicht auch Mundharmonika mit Orchester kombiniert und sogar der Panflöte neues Leben eingehaucht? Thirlwell hat sich stets darauf konzentriert, seine kompositorischen Fähigkeiten auszuweiten, auch mithilfe ungewöhnlicher Instrumente.
Seine Klangvision klingt am deutlichsten aus dem Stück Don’t Want Me Anymore. Es erzählt vom Verlassenwerden und taumelt wie ein angeschlagener Boxer von einem Zustand in den nächsten. Richtig aus dem Ruder gerät es, als ein schepperndes Schlagzeug einsetzt, das nicht den Rhythmus, sondern einen Puls spielt. Das Tempo verändert sich, und der Hörer verliert die Orientierung in deliranten Klangschichtungen.
Thirlwell hat nicht die typische Stimme für so etwas, das fällt auf. Wo sonst oktavensichere Schmachtheinzeln wirken, raunt sich sein rauhes und verlebtes Organ durch den Orchestergraben. In den höheren Lagen wirkt seine Stimme gedrungen. Doch auch das passt, die Koexistenz von Schönem und Hässlichem. Sie entwickelt ihre Qualität im Ringen um Balance.
Schade, dass diese Platte verschollen ist. Aber Musik ist kein Obst — sie überlebt ihre Umstände.
„Love“ von Foetus ist erschienen bei Birdman Records/Rough Trade
Hören Sie hier ![]() „Don’t Want Me Anymore“
„Don’t Want Me Anymore“
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie POP
Take That: „Beautiful World“ (Universal 2006)
ABC: „Lexicon Of Love“ (Mercury/Universal 1982)
Contriva: „Separate Chambers“ (Morr Music 2006)
Justin Timberlake: „Futuresex/Lovesounds“ (Sony/BMG 2006)
Meat Loaf: „Bat Out Of Hell 3“ (Universal 2006)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik