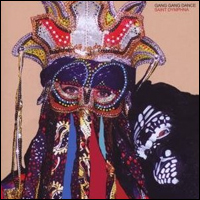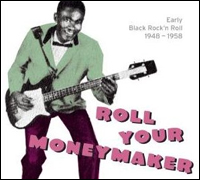Jeden Sonntag gibt’s im Folkmusikhuset auf der ruhigen Insel Skeppsholmen mitten in Stockholm einen Liederabend. Mal dreißig, mal einhundert Menschen spielen volkstümliche schwedische Melodien auf akustischen Instrumenten. Zu Kaffee und Kuchen, Würstchen und Wein wandelt man durch die Räume. Wo es gut klingt, bleibt man und lässt das eigene Instrument erschallen – wenn es gerade passt. Bevor das Pusten, Streichen, Orgeln und Klöppeln zur Kakophonie verkommt, nehmen sich die Musizierenden zurück und stampfen den Takt oder holen sich ein neues Getränk. Trotz der Vielzahl der Klänge bleiben die Melodien klar. Oft tönt es vier, fünf Stunden beinahe ohne Unterbrechung durch die guten Stuben. Viele Gäste lauschen auch einfach nur den warmen Klängen. Das ist echter Weird Folk.
1000 Kilometer südlich von Stockholm musiziert das Dresdener Kollektiv Garda. Und es klingt, als hätten die neun Musiker die Schule des Volksmusikhauses in Skeppsholmen durchlaufen. Ihr Album Die, Technique, Die schwingt in der Stimmung der sonntäglichen Zusammenkunft. Akustische Instrumente raunen ungezwungen im Chor und versprühen den Charme des Improvisierten. In elf Liedern loben Garda das Durchgedrehte, die Wärme, und vor allem die Melodie. Einen besseren Titel als Die, Technique, Die hätten sie ihrem Album nicht geben können.
Entstanden ist die Band um den Sänger und Gitarristen Kai Lehmann und den Schlagzeuger Ronny Wunderwald, die beiden sind als einzige auf Die, Technique, Die fast immer zu hören. Um sie herum scharen sich sieben Freunde: Akkordeon und Klarinette, Cello und Horn, Klavier und Kontrabass erklingen, aber immer nur dann, wenn es nötig ist. Die Gruppe hatte vor, im Wohnzimmer ein bisschen zu experimentieren – und plötzlich war da eine Magie, die sie zu einem Kollektiv schweißte. Die Magie ist auch auf dem Album gegenwärtig.
Neun Leute könnten dick auftragen, Garda sparen sich das. Verschwenderisch mutet die Kargheit mancher Lieder an, etwa beim Titelstück oder bei Mistakes And Failures: Zwei Gitarren und das Klöppeln auf dem Korpus begleiten die melancholische Stimme von Kai Lehmann, dann quietschen die Saiten, es ertönt das Klavier. Dann die Klarinette. Jedes Instrument spielt trägt nur eine Kleinigkeit bei, schließlich ist der Klang aller Reduktion zum Trotz doch warm und voll.
Und so wie die Menschen manchmal das Folkmusikhuset mit dem Gefühl verlassen, etwas Besonderes geschaffen oder gehört zu haben, so lebt auch Die, Technique, Die viel länger, als seine Lieder zu hören sind.
„Die, Technique, Die!“ von Garda ist auf CD und LP bei Schinderwies/KF Records/Broken Silence erschienen.
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie FOLK
Blitzen Trapper: „Furr“ (Sub Pop/Cargo 2008)
Bowerbirds: „Hymns For A Dark Horse“ (Dead Oceans/Cargo 2008)
Bodies Of Water: „A Certain Feeling“ (Secretly Canadian/Cargo 2008)
Fleet Foxes: „s/t“ (Cooperative/Universal 2008)
The Owl Service: „A Garland Of Song“ (Southern Records/Soulfood Music 2008)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik