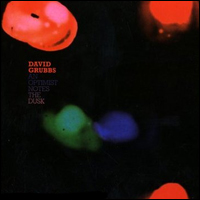Die Lieder der Killers aus Las Vegas funkeln wie die Heimatstadt der Band. Ihr neues Album „Day & Age“ bietet Hochleistungsunterhaltung, die irgendwie allen gefällt
Als The Killers vor wenigen Wochen in der altehrwürdigen Royal Albert Hall auftraten, fand das eigentliche Ereignis hinter der Bühne statt: Die Band aus Las Vegas begrüßte hohen Besuch in der Garderobe. Sir Paul McCartney höchstselbst machte seine Aufwartung und sprach seine Bewunderung aus. Unter die schnöden Massen vor der Bühne hatte sich währenddessen ein anderer Prominenter gemischt: David Cameron, der Vorsitzende der Konservativen Partei.
Das Fazit dieses Ausflugs ins Königreich: Irgendwie können sich momentan alle auf die Killers einigen. Der Grund dafür heißt Day & Age, das dritte Album des Quartetts um den bekennenden Mormonen Brandon Flowers, eine unverfrorene Sammlung von Versatzstücken, mit denen man problemlos das nächstgelegene Stadion zum Toben bringt. So narzisstisch und ungebrochen von der eigenen Größe überzeugt, wagen es heutzutage nicht einmal mehr U2, die Monsterrock-Klischees aus dem Fundus zu kramen, oberflächlich zu entstauben und als letzten Schrei des Gegenwartsrocks zu präsentieren. In der Musik der Killers schwillt den Keyboards der synthetisch schillernde Kamm, ein ewiger Viervierteltakt stapft selbstbewusst daher, Saxofone tröten selbstverliebt, simple Electro-Rhythmen tuckern unschuldig noch das schüchternste Melodiemauerblümchen wird so lange auffrisiert, bis es wirkt wie eine Hymne. Und wie es sich gehört, wird dieses Monstrum von Platte nicht von einem schlichten Song beschlossen, sondern von dem streicher- und bläsergetränkten Epos Goodnight, Travel Well, während dessen sieben Minuten man die Unendlichkeit zu schauen glaubt.
Diese zehn Songs glitzern und funkeln allesamt wie die Heimatstadt der Band, strahlend hell und aus vollster Überzeugung künstlich. Wie im Caesars Palace die römische Antike in Plastik und Pappmaschee wiederaufersteht, basteln sich die Killers eine Funk-Gitarre, stellen Steeldrums aus wie Sensationen in einem Vergnügungspark oder zitieren den Glamrock der Siebziger und die New Wave der Achtziger als bloße schillernde Hülle ohne störende Inhalte. Day & Age ist Hochleistungsentertainment, Vergnügen ohne Reue, Las Vegas in Topform. Ein blendend klingender kleinster gemeinsamer Nenner, auf den sich ein Ex-Beatle und der Chef der Tories verständigen können. Die Massen sowieso.
„Day & Age“ von The Killers ist als CD und LP bei Island/Universal erschienen.
Dieser Text ist entnommen aus dem Musik-Spezial in DIE ZEIT 2008/49.
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie ROCK
Guns N‘ Roses: „Chinese Democracy“ (Geffen/Universal 2008)
Fräulein Wunder: „s/t“ (Vertigo/Universal 2008)
Bloc Party: „Intimacy“ (Cooperative/Universal)
Travis: „Ode To J. Smith“ (Vertigo/Universal 2008)
Oasis: „Dig Out Your Soul“ (Big Brother/Indigo 2008)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik