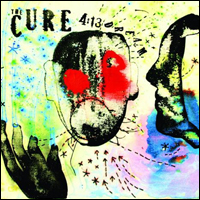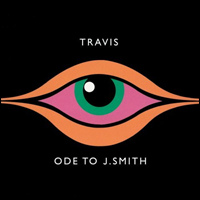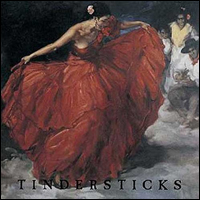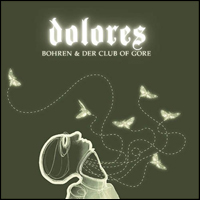Antony Hegartys Stimme steht für sich. Schutzlos wirkt sie, abgetrennt von der Welt. Voller Ausdruck und Gefühl singt er im Grunde nur für sich selbst. Antony Hegarty klingt, als wäre er der letzte Mensch auf Erden.
Dieses Gefühl vermittelte er auf seinem Album I Am A Bird Now, mit dem ihm 2005 weltweit der Durchbruch gelang. Damals kämpfte er gegen Bloc Party, die Kaiser Chiefs und Coldplay um den renommierten englischen Mercury Prize für das beste Album des Jahres – und gewann. Während die Konkurrenz mit den Fans kuschelte, bestand Antony Hegarty auf seiner Einzigartigkeit als Künstler.
In seinen tieftraurigen Stücken besang der in New York lebende Brite seine Metamorphosen, seinen ewigen Wunsch, als Frau aufzuwachen. Er sang vom Begehren, vom Vergeben, von Schuldgefühlen und Angst. Hegarty begleitete sich selbst mit ausdrucksstarkem Klavierspiel, seine zurückhaltende Band The Johnsons steuerte Schlagzeug und Bass bei. Nur hin und wieder brach ein wuchtiger Geigenchor durch die Wolken. Diese androgyne, zittrige Stimme berührte und schmerzte dem Hörer. Die Texte rührten an einen urmenschlichen Kern. Und es gelang Hegarty, komplizierte Gender-Themen der Öffentlichkeit nachvollziehbar zu machen.
Dieser Blick zurück ist nötig, um das neue Minialbum von Antony & The Johnsons, Another World, einzuordnen. Denn in den vergangenen zwei Jahren war Hegarty vor allem in zahlreichen Kollaborationen zu hören, er sang mit Björk und Leonard Cohen und lieh dem Discoprojekt Hercules & Love Affair seine Stimme. Er setzte sich neuen Einflüssen aus. Sind diese auf den fünf Stücken von Another World zu hören?
“I need another world / This one’s nearly gone“, erklingt seine Stimme gleich zu Beginn im Titelstück, untermalt von sanftem Klavier und schräger Flöte. Das Lied klingt reduziert und vertraut. Auch das folgende Shake The Devil ist skizzenhaft – und bricht doch mit den Erwartungen: Nach einer minutenlangen Einleitung spielt ein Saxofon den Blues, ein aufgeräumtes Schlagzeug gibt den Takt an. Und plötzlich klingt Antony Hegarty fast enthusiastisch und kraftvoll. Aus seinen Worten sprechen Tatkraft und – kaum zu glauben – Hoffnung. Gospel und Rhythm’n’Blues erklingen. Doch wer seine Stimme hört, vergisst, dass man Musik bisweilen nach Genres sortiert.
Im Gegensatz zu I Am A Bird Now erhält Hegarty auf Another World eine gleichmäßige Spannung. Es gibt keine furiose Epiphanie, keinen Ausbruch. Manches klingt unfertig, nicht alle Stücke sind überzeugend. Another World klingt also wie genau das Zuckerli, das es sein soll: Es erinnert die Musikwelt an den großen Künstler Hegarty und bereitet sie auf sein drittes Album vor, das Anfang 2009 erscheint.
Und letztlich ist man ja um jeden Ton froh, den Antony Hegarty in die Welt schickt. Vielleicht ist er doch nicht der letzte Mensch auf Erden.
„Another World“ von Antony & The Johnsons ist auf CD und LP bei Rough Trade/Indigo erschienen.
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie POP
The Cure: „4:13 Dream“ (Geffen/Universal)
Tindersticks: „I“ (This Way Up 1993)
Brian Wilson: „That Lucky Old Sun“ (Capitol/EMI 2008)
Dennis Wilson: „Pacific Ocean Blue“ (Caribou 1977/Sony BMG 2008)
„Monkey – Journey To The West“ (XL Recordings/Beggars Banquet 2008)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik