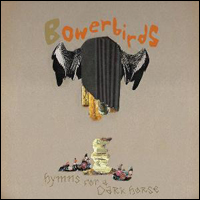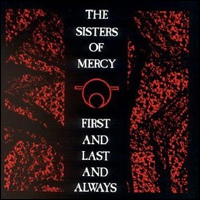Was für eine magische, entrückte Welt, die uns Jun Miyake hier eröffnet! Wenn kleinere Geister als er daran gegangen wären, derart disparate Klangquellgebiete wie die zeitgenössische brasilianische Populärmusik, das französische Chanson, bulgarischen Chorgesang, arabische Lautenklänge, afrikanisches Getrommel, sanften Noise, Orchestermusik und Jazz mit der Pipette abzusuchen, um daraus ein eigenes Wässerchen zu mischen, dann wäre das Destillat vermutlich kaum genießbar gewesen.
Miyake aber, der kosmopolitische Japaner, führt diese Zutaten so geschickt zusammen, dass man sich die Musik seines neuen Albums Stolen From Strangers auflegen möchte wie ein exotisches Parfüm. Die zwölf Stücke, manche davon Miniaturen von kaum einer Minute Dauer, hat der Trompeter, Pianist und Sampling-Künstler alle selbst komponiert, die Texte lieferten ihm seine singenden Gäste – Arto Lindsay, Lisa Papineau, Arthur H. und Remy Kolpa Kopoul.
Während die beiden Letzteren eine eigentümlich raunende, theatralisch-französische Form des Geschichtenerzählens betreiben, klingt Lisa Papineau wie eine Bewohnerin jener verheißungsvollen Gegend, die einer früheren Miyake-Platte den Titel gab: Mondo Erotica. Und der gern auch mal splitterscharfe Arto Lindsay hat vor den Aufnahmen für dieses Album besonders viel Kreide gefressen. Sein Gesang ist die reine Sanftmut.
Jun Miyake, späte 40, stammt aus Tokyo und sehnte sich schon lange nach der Fremde. 15 Jahre tourte er mit seiner Band durch die Clubs in Japan und den USA, wo er Jazz studiert hat. 2005 zog er nach Paris.
Vielleicht muss man aus einem Land wie Japan kommen, um eines derart eleganten und verständigen Raubzugs durch die Musikgeschichte der letzten 100 Jahre fähig zu sein. Ihrem Titel nach spielt die Platte auf Diebstahl bei Fremden an; in einem Song taucht die Metapher im Zusammenhang mit gestohlenen Erinnerungen auf.
Doch so viel fremde Musik Miyake auch verwenden mag: Er ist kein echter Dieb, eher ein großartiger Verführer. Seiner Beute nähert er sich mit begehrlichem Auge, doch statt sie wie Trophäen auszustellen, lässt er uns, wie alle guten Liebhaber, an seiner Faszination fürs Fließende teilhaben. Zum Glück. Wäre er nicht mit diesem unwahrscheinlichen Schönheitssinn begabt, wir müssten uns fast vor Jun Miyake fürchten.
„Stolen From Strangers“ von Jun Miyake ist bei Enja Records/Soulfood Music erschienen.
Dieser Text ist dem Musikspezial der ZEIT Nr. 42 entnommen.
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie JAZZ
Jean-Luc Guionnet & Toshimaru Nakamura: „Map“ (Potlatch 2008)
Bobo Stenson Trio: „Cantando“ (ECM 2008)
e.s.t.: „Leucocyte“ (Act/Edel 2008)
Bunky Green: „Live At Jazz Baltica“ (Traumton/Indigo 2008)
James Carter: „Present Tense“ (Universal/Emarcy 2008)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter zeit.de/musik