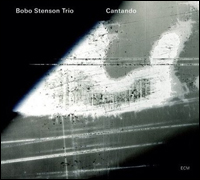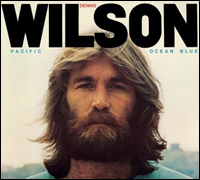Everlast ist ein Mann der großen Worte. Sätze wie „Wenn du keine Ehre hast, besitzt du gar nichts mehr“, kommen ihm ganz selbstverständlich über die Lippen. Und Everlast ist unzufrieden mit dem Stand der Dinge im HipHop. Es mangele den Rappern an Ehre, Anstand, dem Genre an Identität, sagte er vor einiger Zeit. Ob er es besser kann als all die anderen? Sein neues Album Love, War And The Ghost Of Whitey Ford gibt Aufschluss darüber.
Aus Neros brennendem Rom schallen schmissige Fanfaren herüber, ein Knall, dann geht es richtig los. Erik Schrody alias Everlast meldet sich kehlig zu Wort und rappt über einen Beat, der beinahe so alt klingt wie die Tröten zuvor. Welches Jahr tönt hier? 1990? 1991? Oder 1992? Uralt jedenfalls. Der Beat scheint aus einer Zeit zu stammen, als es im HipHop noch um Anstand und Untergrund ging und nicht um Goldkettchen, Mädchen und Diamanten. Auf diesen züchtigen Rhythmus reimt Everlast eine Lyrik, die ebenfalls historisch anmutet. Er beschimpft – disst – die New York Times und CNN, das mufft nach Hardcore-HipHop alter Tage.
In der Folge entfaltet sich das bislang größte Rap-Desaster des Jahres 2008. Schon im nächsten Stück versucht sich Everlast an Johnny Cashs Folson Prison Blues, dem er das alte Quietsch-Sample seiner früheren Band House Of Pain implantiert. Außer jenem Selbstzitat und überfetteten Beats weiß er nichts hinzuzufügen. Auch der Rest des Albums ist eine Enttäuschung: Stone In My Hand verschwurbelt Westernrock mit The Clash und Pathos – hier wird deutlich, wie wenig Strahlkraft Everlasts Stimme hat.
Wie schon früher singt Everlast aus der Sicht eines gewissen Whitey Ford. „Whitey Ford ist eine Beschreibung, eine Farbe einer Kreide, eine Person, durch die ich sprechen kann. Sie erlaubt mir, Dinge über mich zu sagen, die ich sonst vielleicht nicht sagen würde“, beschreibt er die Figur. Genau da liegt das Problem: Auf seinem neuerlichen Parforceritt durch die Stile, durch Soul, Elektrofunk, Blues, HipHop, Folk, Orientalismen, Western und Rock bleibt der Künstler auf der Strecke.
Einigermaßen erträglich sind immerhin jene Stücke, in denen Everlast sich zurückhält. Friend etwa ist ein solches Lied. Aus ein paar Klampfenakkorden formt er etwas, das viel stärker klingt als die überladenen Klangkaskaden anderer Stücke. Nichts als Dunkelheit habe er im Herzen, singt er. Und das Bedröppelte steht ihm besser als die Wut. Dem traurigen Lagerfeuer-Gitarristen Everlast hört man gern zu, der wütende HipHopper Everlast hingegen klingt nach Vorgestern. Da mag er noch so viel Anstand und Ehre in sich tragen.
„Love, War And The Ghost Of Whitey Ford“ von Everlast ist bei PIAS/Rough Trade erschienen.
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie HIPHOP
Roots Manuva: Slime & Reason (Big Dada/Rough Trade 2008)
Stereo MCs: „Double Bubble“ (PIAS/Rough Trade 2008)
Guilty Simpson: „Ode To The Ghetto“ (Stones Throw/Groove Attack 2008)
„An England Story“ (Soul Jazz Records/Indigo 2008)
Buck 65: „Situation“ (Warner 2008)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik