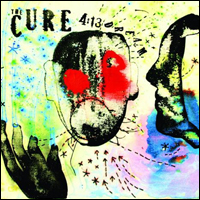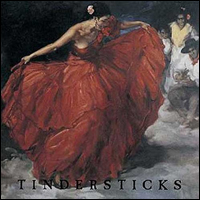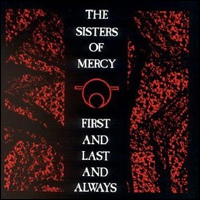Das Musikgeschäft ist ungerecht. Wer seine Aufnahmen bei einer kleinen Plattenfirma unterbringt, hat noch lange nicht gewonnen, denn der Schlüssel zum Erfolg ist der Vertrieb. Der sorgt dafür, dass die Aufnahmen im Plattenkaufhaus und bei Netzhökern zu erstehen sind. Sieht man seine eigene Platte dann im Laden stehen, hat man dennoch nichts gewonnen, denn sie fällt niemandem auf. Also muss eine findige Werbeagentur ran. Unterwegs haben schließlich so viele ein paar Euro verdient, dass der Musiker sich mit wenigen Cent zufrieden geben muss. Um daraus wiederum ein paar Euro zu machen muss er ziemlich viele Platten verkaufen.
Theoretische Alternativen gibt es natürlich, vor allem das Internet gilt vielen als Heilmittel gegen all die Wehwehchen des Geschäfts, als Garant der Chancengleichheit. Und tatsächlich: Ein, zwei mal im Jahr lassen MySpace und YouTube neue Sternchen aufblitzen. Doch wer wollte sich auf diesen Zufall verlassen?
Norman Palms Rezept ist ein anderes, es geht ungefähr so: Drei mal täglich vor und nach den Mahlzeiten alles selber machen. Seine ersten Lieder stellte er nicht einfach hoffnungsvoll ins Netz, sondern er ließ sie in Vinyl drücken und schickte die Singles eigenhändig an eine erkleckliche Zahl von Musikjournalisten. Zwei entzückende Coverversionen waren drauf, Girls Just Wanna Have Fun von Cindy Lauper und Boys Don’t Cry von The Cure.
Sein Debütalbum Songs bringt nun Ratio Records raus, ganz ohne Vertrieb. Das Label betreibt er mit drei Freunden. Und man kann Songs kaum übersehen: Es ist nicht wie normale Werbesilberlinge in ein karges Papphüllchen gewandet, auch nicht in die sonst übliche schäbige Plastikkiste. Nein, Norman Palm verschickt sein Album als Beilage eines dicken Buchs. Das fällt nicht nur auf, weil es jeden CD-Stapel zum Einsturz bringt. Das sieht auch verdammt hübsch aus und will gehört werden.
Es wird gehört: Zwölf leichtfüßige Lieder singt er und macht auch hier fast alles selbst. Mehr als die Gitarre und seine schwere, amerikanische Zunge ist meist nicht zu hören. Manchmal singt er mit sich selbst im Chor und spielt eine Maultrommel. Und ganz selten darf mal jemand anderes den Klang von Schlagzeug, Klavier oder Teekisten-Bass beisteuern.
Zu Beginn erzählt er, was er alles nicht könne: Tanzen und Reiten etwa, oder einen Refrain schreiben, Singen. Doch gleich das zweite Stück Bitterness And Aftertaste widerlegt seine Selbsteinschätzung: Eine charmante Melodie, ein paar Zupfer an der Akustischen – mehr braucht es nicht zum liebenswerten Poplied. So geht es weiter, meist luftig, manchmal getragen, immer melodiös. Vierzig Minuten später krabbeln zwölf wuselige Ohrwürmer durchs Zimmer. Wahrscheinlich kann Norman Palm auch Reiten und Tanzen.
Was in seiner Biografie wohl erlogen ist, entscheide jeder selbst: Er wuchs in Norddeutschland auf, früh lernte er mehrere Instrumente spielen. Nach der Schule wollte er Rechtsanwalt werden, doch seine Eltern überredeten ihn, auf die Kunsthochschule nach Berlin zu gehen. Dort gefiel es ihm, er schrieb viele Lieder und begann diese während eines Aufenthalts in Paris in das Mikrofon seinen Laptops zu singen. Er gestaltete ein kleines Büchlein, in dem er seine Lieder illustrierte. Bald durfte er sie in Galerien und auf Festivals spielen. Da es ihm nicht gefiel, dass die Leute ihn anstarrten, ließ er bei Auftritten jemanden sein Buch durchblättern und projizierte es an die Wand. Heute pendelt er zwischen Mexico City und Berlin.
Songs sind die Lieder aus Paris und ein kleines Buch. Das unterhaltsame an seinen zweihundert Seiten ist die Formenvielfalt. Jedem Stück ist ein Kapitel gewidmet. Oft sind die Liedtexte typografisch gestaltet, mal in Leuchtschrift, mal in seiner Handschrift. Daneben stehen mal versierte, mal krakelige Zeichnungen von Sperma, Krokodilen und abgeschnittenen Zungen. Oh, Elisa zieren scheinbar zufällige Momentaufnahmen aus Paris, Berlin, London und Mexico City, den Middletown Blues begleiten ein Dutzend Polaroids voll typischer Kleinstadttristesse, zu Boys Don’t Cry schauen ein paar geschminkte Jungs in die Kamera.
Bild und Ton ergänzen sich, nach mehrfachem Durchblättern und -hören mag man gar nicht mehr entscheiden, was zuerst da war. Warum macht das nicht jeder so? Ach, ja richtig, das Geschäft. Ein solches Album würde mit der gängigen Anzahl von Mitverdienern wohl gut 30 Euro kosten.
„Songs“ von Norman Palm ist als Buch plus CD bei Ratio Records erschienen. Erhältlich ist das Album in dieser Form nur in einem Plattenladen in Berlin, im Webshop des Labels und bei A.N.O.S.T.
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie POP
David Grubbs: „An Optimist Notes The Dusk“ (Drag City/Rough Trade 2008)
Of Montreal: „Skeletal Lamping“ (Polyvinyl/Cargo Records 2008)
Antony & The Johnsons: „Another World“ (Rough Trade/Indigo 2008)
The Cure: „4:13 Dream“ (Geffen/Universal)
Tindersticks: „I“
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik