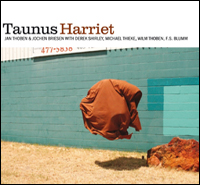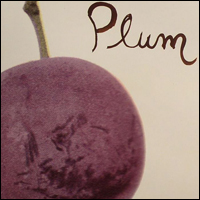So nah kam F.S. Blumm aus Bremen dem Pop noch nie: Auf „Everybody Loves“ verbindet der Gesang der Schwedin Bobby Baby seine lockeren Gitarrenmuster zu richtigen Liedern.

Es gibt Platten, über die möchte man schreiben – aber es ist schon alles geschrieben. Die Musizierenden kleben auf den Magazintiteln, und von Brigitte bis Bravo, von FAZ bis taz tönt einhellige Begeisterung. Meist bleibt rätselhaft, was an dem jeweiligen Popentwurf so besonders sein soll. Eine Behauptung scheint den Schreibern schon als Argument zu reichen. Da kann, da mag man oft nicht mithalten und schweigt.
Es gibt andere Platten, über die schreiben nur Wenige. Die lassen sich nicht als Popsensationen abfeiern, weil die mediale Aufmerksamkeit zu gering ist. Eine Sensation lässt sich schließlich nur ausrufen, wenn (fast) alle einstimmen. Dennoch gleichen sich auch die Abhandlungen über solch unbeachtete Platten. Dominieren im ersten Fall die vermeintlich kräftigen Substantive – Revolution, Sensation, Wunderwerk – so stürzen im zweiten Fall nicht selten Geröllberge von Adjektiven und Spezialwissen auf den Leser ein und nehmen ihm die Lust aufs Hören.
Frank Schültge aus Bremen … weniger sensationell kann ein Satz wohl nicht beginnen. Frank Schültge aus Bremen also streut seit zehn Jahren in kurzen, regelmäßigen Abständen wenig beachtete Töne in die Welt. Meist nennt er sich F.S. Blumm, mit anderen Musikern zusammen auch Kinn. Seine Aufnahmen klingen elektronisch, dabei entstehen sie zumeist akustisch. Diverse Plattenfirmen – viele von ihnen so bescheiden, dass sie sich selbst nie Firma nennen würden – bringen seine Alben und Singles heraus. Manches Magazin schenkt ihm Aufmerksamkeit, die meisten Berichte ergötzen sich an der Schönheit seiner instrumentalen Lieder.
Schön ist seine Musik, oder nicht? Was heißt eigentlich schön? Blumm malt ja keine Bilder*, die man sich an die Wand hängt, die man betrachtet und die aus ihrer Kunstfertigkeit heraus Wohlempfinden spenden. Musik findet man schön, wie man Menschen nett findet. Schöne Musik läuft nebenher und stört niemanden. Blumm musiziert detailreich und behutsam. Seine Musik ist nicht schön, sie braucht Aufmerksamkeit.
In letzter Zeit musiziert er gern mit anderen. Eine Platte nahm er mit dem Trompeter Luca Fadda auf, ein Minialbum mit der Französin Anne Laplantine. Seine Zusammenarbeit mit der Schwedin Bobby Baby alias Ellinor Blixt dokumentiert nun das Album Everybody Loves, erschienen unter dem Namen Bobby & Blumm.
So nah wie hier kam er dem Pop noch nie. Ellinor Blixt besingt die Lieder mit ruhiger Stimme, manchmal singt er ein paar Zeilen mit. Ihre Linien verbinden Blumms lockere Muster zu richtigen Liedern. Meist spielt er Gitarre, mal ein Xylophon und eine Orgel. Viele Geräusche kann man gar nicht zuordnen, dabei hört man immer nur sehr wenige auf einmal. Oft ist einfach nur Stille. Da sei »das Knacksen von Schellack-Platten, das Streicheln von Kleiderbürsten, von Fingerspitzen auf Pergamentpapier, klappernde Kleiderbügel im Nachtzug nach Krakau«, teilt der Pressetext mit. Man muss wirklich ganz genau hinhören.
»Ruhig« und »still« wird diese Musik genannt. Dabei brodelt es unter der sparsam instrumentierten Oberfläche gehörig. Die Lieder stecken voller Wendungen und Brüche. Und, kann Musik überhaupt still sein? »Fragil« und »skizzenhaft« sei sie, als wüssten Bobby & Blumm nicht so genau, wo das alles hinführen solle, als klängen ihre Lieder unfertig – als hätten die beiden sich womöglich keine rechte Mühe gegeben. Dabei ist den Kompositionen wahrlich nichts hinzuzufügen, sind sie gerade so komplex, wie sie eben sein müssen.
Beim letztjährigen Fusion-Festival trat F.S. Blumm in einem riesigen Iglu auf. Kaum erhöht saß er allein in der Mitte des Raumes, mit einer Gitarre, einem Kamm, einer Spieluhr und einem winzigen Effektgerät. Das Effektgerät fütterte er mit Klacken und Bimmeln, es machte einen Rhythmus draus. Über diesem zupfte er dann seine Gitarre. Nach einer Stunde wollten die Menschen mehr hören, erst wiederholte er ein Lied, dann erklärte er, wie das mit dem Effektgerät und den Geräuschen funktioniere. Klang alles ganz einfach.
* Zugegeben, F.S. Blumm malt doch Bilder, genauer: er zeichnet. An die Wand hängen sich seine Werke wohl wenige, und schön kann man sie auch nicht nennen. Aber sehen Sie selbst »
„Everybody Loves“ von Bobby & Blumm ist als CD und LP bei Morr Music erschienen.
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie POP
Santogold: „s/t“ (Lizard King/Rough Trade 2008)
Death Cab For Cutie: „Narrow Stairs“ (Atlantic/Warner Music 2008)
Bernadette La Hengst: „Machinette“ (Trikont/Ritchie Records 2008)
Scarlett Johansson: „Anywhere I Lay My Head“ (Warner Music 2008)
The Notwist: „The Devil, You + Me“ (City Slang 2008)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik