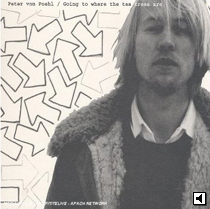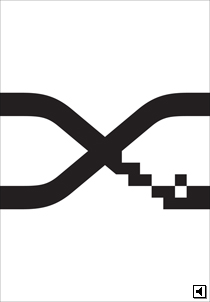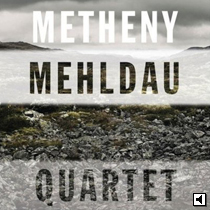Im Land der Teebäume singen holde Feen Weihnachtslieder, und die Bläser der Heilsarmee scheppern klagend. Der Schwede Peter von Poehl singt, als hätte sich Brian Wilson in die Tundra verirrt
Wenn der schwedische Musiker Peter von Poehl deutsch spricht, hat er einen auffälligen österreichischen Akzent. Ob es daran liegt, dass er lange mit dem österreichischen Musiker Florian Horwath zusammengearbeitet hat? Gemeinsam werkelten sie in der Graefestraße in Berlin an Aufnahmen, Graefe Recordings nannten sie sie. Deutsch habe er aber von seinem Vater gelernt, erzählt der 33-jährige von Poehl. Seine Mutter ist Schwedin. In Schweden ist er aufgewachsen, von dort hat es ihn 1998 nach Frankreich verschlagen, dann vor zwei, drei Jahren nach Berlin, genauer Kreuzberg. Er arbeitete mit Bertrand Burgalat zusammen, begleitete den Autor Michel Houellebecq auf Tournee und produzierte das letzte Album des Königs der Nouvelle Chansons, Vincent Delerm.
Was hat ihn nun dazu gebracht, an eigenen Stücken zu arbeiten? „Um ehrlich zu sein: Ich musste diese Platte machen, ich hatte keine Wahl.“ Das Album Going To Where The Tea Trees Are ist zur Hälfte in Schweden und zur anderen Hälfte in Deutschland entstanden, Aufmerksamkeit wurde ihm zuerst in Frankreich zuteil. Beim Pariser Sender Radio Nova wurde seine erste Single Going To Where The Tea Trees Are zum Hit.
Wenn man in Schweden aufwächst, berichtet er, habe man nur zwei Möglichkeiten: „Entweder du spielst in einer Rockband oder Fußball. Ich war immer eher derjenige, der in der Rock- oder Garagenband gespielt hat. In meiner Heimatstadt Malmö bekamen wir den Proberaum von der Stadt gestellt. Wir haben monatlich sogar 50 Euro erhalten, um uns Instrumente zu kaufen. Natürlich haben wir davon eher Bier gekauft.“ Gibt es diese Förderung junger Bands noch immer? „Ich glaube nicht. Aber zu meiner Zeit waren auch die staatlichen Musikschulen für alle Kinder frei. Es ist ein Grund dafür, dass es so viele schwedische Bands gibt.“
Going To Where The Tea Trees Are erzähle vor allem von seiner komischen Beziehung zu seinem Heimatland. Man könnte auch sagen: von der Suche nach einer Heimat. „Schweden ist für mich einerseits bekannt, andererseits vollkommen fremd. Eine wirkliche Heimat habe ich noch immer nicht gefunden.“ In Berlin glaubte er anfangs, einen solchen Ort gefunden zu haben: „Berlin ist weit genug entfernt von Schweden, aber auch nicht zu sehr. Ich glaube, in Schweden gibt es pro Quadratkilometer zehn Menschen, in Paris eine Million. Und in Kreuzberg? In der Graefestraße, hatte ich das Gefühl, gibt es einen Graefe pro Quadratmeter. Das hat mir sehr gut gefallen.“
Mit subtilen Arrangements nimmt er die Hörer gefangen. Kindergitarre und Bläserensemble gehören für Peter von Poehl zusammen. Mit hauchzarter Stimme singt er zur akustischen Gitarre von der Sehnsucht nach einem Platz im Leben, vom Reisen und der Tooth Fairy, der Zahnfee. Saxofon und Tuba, Cello, Flöte, Klarinette und analoge Keyboards umspielen sich. Mit schwedischem Garagenrock hat das wenig zu tun.
Spricht durch die opulenten Hintergrundchöre ein Brian Wilson aus der schwedischen Tundra zu uns? Der Vergleich sei sehr schmeichelhaft und mache ihn stolz, sagt von Poehl, aber eigentlich seien seine Stücke weit mehr von schwedischen Weihnachtsliedern beeinflusst, als von den Beach Boys. „Als Kind habe ich im Schulchor gesungen. Die Arrangements kommen daher. Mich hat damals auch die Kapelle der Heilsarmee sehr beeindruckt. Deshalb verwende ich Bläser. Bei uns gab es in jedem Klassenzimmer ein Harmonium. Jeder Morgen begann mit Musik. Die Lehrerin setzte sich ans Harmonium und begann zu singen, wir stimmten ein.“
“Home is where my heart is”, singt er in A Broken Skeleton Key. Englische Texte, deutschsprachige Interviews, französisches Lebensgefühl und schwedische Erziehung: Irgendwo dazwischen liegt die Heimat des Peter von Poehl. Sein Album träumt ausgehend von den musikalischen Eindrücken seiner Kindheit vom Pop der Gegenwart. Seit Kurzem führe er das auch hin und wieder opulent live auf – „mit zehn Musikern, Bläsern und allem drum und dran“. In Paris trat er mit großer Besetzung unlängst sogar in der altehrwürdigen Cigale auf.
Hören Sie hier ![]() „A Broken Skeleton Key“
„A Broken Skeleton Key“
„Going To Where The Tea Trees Are“ von Peter von Poehl ist erschienen bei Herzog Records/Edel Contraire
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie POP
The Go Find: „Stars On The Wall“ (Morr Music 2007)
Brett Anderson: „Brett Anderson“ (V2 2007)
Air: „Pocket Symphony“ (Astralwerks/Virgin 2007)
Yoko Ono: „Yes, I’m A Witch“ (Astralwerks/Virgin 2007)
Tokio Hotel: „Zimmer 483“ (Universal 2007)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik