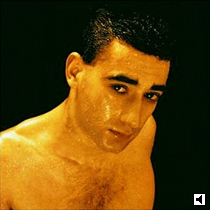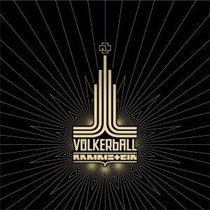Der Gitarrist Grant Green servierte dem Publikum des „Club Mozambique“ im Januar 1971 perlende Soli auf brodelndem Fundament. Dazu röhrten schrill und heiser die Saxofone – James Brown ließ grüßen
Grant Green wird häufig vergessen, wenn es darum geht, die Gitarren-Genies der Jazzgeschichte zu benennen. Anfang der sechziger Jahre war er der lässige König der E-Gitarre, beim Jazzlabel Blue Note gehörte er in dieser Zeit zu den Musikern mit den meisten Einspielungen. Er erfand das moderne Gitarrenswingtrio neu. Im Jahr 1979 starb er in New York mit nur 43 Jahren hinter dem Steuer seines Wagens an einem Herzinfarkt. Viele Aufnahmen sind bis heute unveröffentlicht.
Mit Live At Club Mozambique macht Blue Note nun eine dieser Aufnahmen zugänglich. Sie stammt von Anfang des Jahres 1971. Die acht Stücke wurden bei zwei Auftritten im Detroiter Flachdachschuppen Club Mozambique mitgeschnitten. Da die originalen Mehrspurbänder nicht überlebt haben, wurde die CD von einem damals entstandenen Mono-Mix produziert. Ein Wehmutstropfen, der leicht zu verschmerzen ist, denn der Zauber, den Green und Band damals entfachten, blieb erhalten.
Green hatte seine ganz große Zeit damals schon hinter sich. Im Jahr 1966 hatte er sich für einige Zeit von Blue Note getrennt, wegen seiner Drogenabhängigkeit war er zwei Jahre lang musikalisch inaktiv. Bestimmte der gelassene Klang des eleganten Gitarristen die frühen Sechziger, so wurde er nun von anderen in den Schatten gestellt, Wes Montgomery und später George Benson waren die neuen Innovatoren. Greens Comeback im Jahr 1969 blieb weitgehend unbeachtet.
Zu Unrecht. Während seiner Pause hatte er sich einiges bei James Brown und dem Motown-Soul abgehört. Ende des Jahres 1969 gründete er in der Industriestadt Detroit eine neue Gruppe und servierte dem Publikum seine kühl perlenden Gitarrensoli fortan auf einem funkig brodelnden Fundament.
Die beiden Heimspiel-Abende im Club Mozambique zeugen davon, wie tanzbar der Gitarrist Jazz mit den damals angesagten Rhythmen und Klängen verlötete. Heiser und schrill röhren und quietschen die Saxofone (Clarence Thomas und, als Gast, Houston Person), während die Orgel von Ronnie Foster scharf die Akkorde setzt und die Stücke vorantreibt. Den besonderen Dreh erhalten die Aufnahmen durch den irrwitzigen Schlagzeuger Idris Muhammad, auf unnachahmliche Art lässt er die Hi-Hat scheppern und unterlegt den Auftritt mit rhythmischem Feuer.
Derart angeheizt wird am frostigen Januarabend selbst aus der Burt-Bacharach-Schnulze Walk On By eine mitreißende Tanznummer. Live At Club Mozambique führt vor, wie heiß auch zeitgenössischer Jazz klingen könnte. Und gegen kalte Füße wirkt die Platte sowieso.
„Live At Club Mozambique“ von Grant Green ist erschienen bei Blue Note/EMI
Hören Sie hier ![]() „Walk On By“
„Walk On By“
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie JAZZ
OOIOO: „Taiga“ (Thrill Jockey 2006)
Koop: „Koop Islands“ (Compost 2006)
Soweto Kinch: „A Life In The Day Of B19: Tales Of The Tower Block“ (Dune 2006)
Pharoah Sanders: „The Impulse Story“ (Impulse 2006)
William Parker: „Long Hidden – The Olmec Series“ (AUM 2006)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik