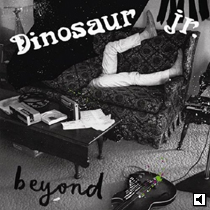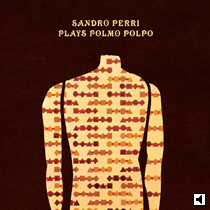„Zeig mir jemanden in diesem Gebäude, der noch kein Star ist, und ich mache einen aus ihm, egal, wer es ist. Er wird ein Star, weil wir die Platte machen, weil unsere Rhythmus-Sektion der Star ist.“ Das soll Nile Rodgers zu Jerry Greenberg, dem damaligen Präsidenten von Atlantic Records, gesagt haben. Chic, die Erfindung des Bassisten Bernard Edwards und des Gitarristen Nile Rodgers, hatten gerade mit Le Freak einen Hit gelandet und waren dabei, ihr Album C’est Chic einzuspielen. Schlagzeuger Tony Thompson – man nannte ihn auch „das menschliche Metronom“ – komplettierte die Band.
Hauptsächlich arbeiteten Rogers und Edwards unter dem Namen Chic Organization Ltd. als Produzenten. Ihr Konzept basierte auf der Anonymität der Produzenten und einem distinktiven Klang. Sie hätten die Rolling Stones produzieren können, die gerade auf der Suche nach Produzenten waren. Aber sie entschieden sich für Sister Sledge, eine vierköpfige Gesangsgruppe, die bereits seit einigen Jahren moderat erfolgreiche Stücke an der Grenze zwischen Motown-Soul und Disco veröffentlichten.
Chic nahmen die Schwestern unter ihre Fittiche und spielten das Album We Are Family ein, einen Klassiker der ausklingenden Disco-Ära. Die Singles He’s The Greatest Dancer, Lost in Music und das Titelstück We Are Family wurden Hits, noch heute gehören sie zum Funk-, Soul- und Disco-Kanon. Der Groove ist präzise, straff und unwiderstehlich wie bei James Brown, die Texte sind clever und die Melodien eingängig.
Das Album ist die erste rundherum perfekte Chic-Produktion. Jedes Stück ist großartig: Somebody Loves Me ist eine betörende Soul-Ballade, Thinking Of You besitzt einen zwingenden Groove, Easier To Love ist ein luftiges Sommer-Lied, You’re A Friend To Me vermählt einen gelassenen Reggae-Rhythmus mit zartem Disco-Schmelz und One More Time ist lässig und hypnotisch zugleich. Zusammen ergeben die Stücke ein geschlossenes Ganzes, eine Seltenheit in der Disco-Ära, die von Singles bestimmt wurde. Chic sollte dieses Kunststück noch zweimal gelingen: mit ihrem eigenen Album Risqué und mit Diana Ross‘ Diana.
Sister Sledge waren mehr als die hübschen Gesichter zur mächtigen Rhythmusgruppe Chic. Die Hauptsängerin Kathy und ihre Geschwister Debra, Joan und Kim verschoben den Fokus gehörig. Lag der Gesang von Alfa Anderson und Luci Martin auf den Chic-Platten irgendwo zwischen Soul und der entkörperlichten Perfektion einer gut geölten Maschine, so gab der kräftige, in der Gospel-Tradition stehende Gesang der Schwestern den doppelbödigen Stücken eine neue Richtung. Die von Chic geschriebenen Lieder waren oberflächlich betrachtet hedonistische Party-Hymnen. Die unerbittlich harten Grooves und die insistierenden glasklaren Streicher mit ihren um sich selbst kreisenden Arrangements deuteten auf die dunkle Seite des Disco-Eskapismus hin.
„Caught in a trap, no turning back“ heißt es bei Lost In Music. Gesungen wird der Refrain vom luftigen Chic Choir. Im Zentrum des Stücks steht Kathy Sledges passionierter Gesang: „I feel so alive, I quit my nine to five“ intoniert die damals Neunzehnjährige voller naiver Überzeugung. Wo die Chic-Stücke zutiefst ironisch waren, vermittelten Sister Sledge das Gefühl, dass ein Entkommen sehr wohl möglich sei – auch wenn der Chor eine andere Sprache singt. Das zutiefst ambivalente Konzept der Party-Hymnen, die gleichzeitig von der Leere und Vergeblichkeit des Disco-Gefühls und der angeblichen Befreiung durch die Musik sprechen, wird durch die Ehrlichkeit und Überzeugung der Geschwister noch stärker aufgeladen. Darum funktionieren diese Lieder auch nach dem tausendsten Hören (und nach 28 Jahren) immer noch, als seien sie gerade erst entstanden.
„We Are Family“ von Sister Sledge ist im Jahr 1979 bei Atlantic/Warner erschienen
…
Weitere Beiträge aus der Serie ÜBER DIE JAHRE
(22) Rechenzentrum: „The John Peel Session“ (2001)
(21) Sonic Youth: „Goo“ (1990)
(20) Flanger: „Spirituals“ (2005)
(19) DAF: „Alles ist gut“ (1981)
(18) Gorilla Biscuits: „Start Today“ (1989)
(17) ABC: „The Lexicon Of Love“ (1982)
(16) Funny van Dannen: „Uruguay“ (1999)
(15) The Cure: „The Head On The Door“ (1985)
(14) Can: „Tago Mago“ (1971)
(13) Nico: „Chelsea Girl“ (1968)
(12) Byrds: „Sweetheart Of The Rodeo“ (1968)
(11) Sender Freie Rakete: „Keine gute Frau“ (2005)
(10) Herbie Hancock: „Sextant“ (1973)
(9) Depeche Mode: „Violator“ (1990)
(8) Stevie Wonder: „Music Of My Mind“ (1972)
(7) Tim Hardin: „1“ (1966)
(6) Cpt. Kirk &.: „Reformhölle“ (1992)
(5) Chico Buarque: „Construção“ (1971)
(4) The Mothers of Invention: „Absolutely Free“ (1967)
(3) Soweto Kinch: „Conversations With The Unseen“ (2003)
(2) Syd Barrett: „The Madcap Laughs“ (1970)
(1) Fehlfarben: „Monarchie und Alltag“ (1980)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik