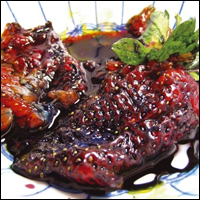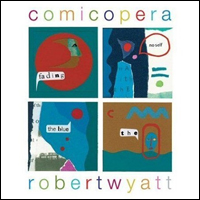
Robert Wyatt auf einen Stil festzulegen ist unmöglich. Mal spielt er Pop, mal Jazz, mal Folk, meist alles auf einmal. Auch sein neues Album Comicopera lebt vom Facettenreichtum des Musikers, der seit einem Sturz aus dem dritten Stock im Jahr 1973 an den Rollstuhl gefesselt ist. Wie eine wirkliche Oper ist das Album in drei – musikalisch und thematisch allerdings vollkommen unterschiedliche – Akte unterteilt, jeder hat die Länge einer Schallplattenseite. Das sei die zeitliche Einheit, in der er musikalisch denken und planen könne, sagt er. So sei auch seine erste lange Komposition entstanden, Moon In June auf dem dritten Album seiner ehemaligen Band Soft Machine. Länger ginge nicht.
Der erste Akt heißt Lost In Noise, obwohl er recht zugänglich und gar nicht krachig ist. Er beginnt mit Stay Tuned, einem Stück geschrieben von Anja Garbarek. Robert Wyatt ist ein Meister der Coverversion. Er hat die Fähigkeit, fremde Stücke – sei es Biko von Peter Gabriel oder At Last I Am Free von Chic – so zu interpretieren, dass sie wie für ihn geschrieben klingen. In diesem Fall ist das Arrangement üppiger als das des Originals. Er lässt gar eine Sopranistin Vokalisen singen. Mehr Oper gibt es nicht auf diesem Album.
Das Instrument, mit dem Wyatt sich fremde Stücke zu eigen macht, ist seine traurige Stimme. Sie verleiht auch einfachen Stücken Tiefe. Bei A.W.O.L ist das so, es ist eines von vier Stücken, das seine Lebensgefährtin Alfreda Benge für ihn schrieb. Es handelt von einer Frau, die ihren Mann verloren hat. Wyatts Stimme kommuniziert die Einsamkeit und Verlorenheit der Frau so eindringlich, dass man weinen möchte. Gleichzeitig spendet seine Stimme Trost wie kaum eine zweite. Berührend ist auch das autobiografische Stück Just As You Are, eine Auseinandersetzung mit seiner überwundenen Alkohol-Krankheit. Er singt von den Lügen, die er Alfreda Benge in dieser Zeit erzählte, und davon, dass sie sich um das einzige betrogen fühlte, was sie von ihrer Beziehung verlangte, um die intelligente Unterhaltung. Monica Vasconcelos singt in dem Duett Benges Stimme. Das Stück stimmt traurig. Kennt man den biografischen Hintergrund nicht, funktioniert es als einfaches Liebeslied.
Im zweiten Akt The Here And The Now mischt sich das Persönliche mit dem Gesellschaftlichen. Wir hören Wyatt, den Zweifler. Be Serious – Paul Weller steuert hier eine beschwingte Jazz-Gitarre bei – beneidet die Muslime, Christen, Hindus und Juden um die Sicherheit, die ihnen ihre Religion bietet. „It must be great to be so sure.“ Robert Wyatt ist Atheist.
Manchmal klingt er wie ein Verzweifelnder. Garcia Lorcas Cancion De Julieta ist das zentrale Stück des letzten Aktes Away With The Fairies, es ist ein Jazz-Trauermarsch voller sirrender Streicher und sanft geschlagener Hi-Hats. On The Town Square ist eine Feier des Kollektivismus – eine instrumentale Calypso-Nummer mit Saxofon-Solo.
Ein anderes instrumentales Stück auf dem neuen Album heißt Anachronist. Wyatt trägt diesen Titel schon seit Jahren wie eine Auszeichnung. Er trat der kommunistischen Partei Englands bei, als die kommunistischen Regime in Europa zusammenbrachen, als Geste des Danks. Mit der kubanischen Revolutionshymne Hasta Siempre Commandante erweist er am Ende des Albums Ché Guevara Tribut, er habe seiner Generation Hoffnung gegeben. Das beschwingte Latino-Jazz-Klavier nimmt sich dissonante Freiheiten heraus, die Perkussion torkelt. Die Utopie des Stücks ist ins Wanken geraten, aber es ist alles, was geblieben ist. Es endet mit sehnsuchtsvoll hauchenden Frauenstimmen und einem an Evan Parker erinnernden Solo. Das ist der Klang der Freiheit – oder zumindest der freien Improvisation.
Das bringt uns zu Wyatt, dem Jazz-Musiker. Robert Wyatt war bis zu seinem Unfall Schlagzeuger und Sänger bei Soft Machine, aktiv an den beiden musikalischen Polen der Band, Jazz und Pop. In Mob Rule und Out Of The Blue klingen jazzige Skalen, als seien sie falsch gestimmt. Mob Rule ist skizzenhaft – eine weitere seiner Stärken – Out Of The Blue ein tumultöses, kakophones Meisterwerk. Ein Arrangement aus Stimmsamples, Bläsersätzen und Keyboard-Stichen, überragt von Wyatts ungewöhnlich insistierendem Gesang.
In einem ist Comicopera wie eine richtige Oper: in seiner Emotionalität. Verwirrung und Verzweiflung, Hilflosigkeit und Einsamkeit, aber auch Hoffnung, Sehnsucht, Trost und Freude, es ist alles da.
„Comicopera“ von Robert Wyatt ist als CD und Doppel-LP erschienen bei Domino Records.
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie POP
Young Galaxy: „Young Galaxy“ (Arts & Crafts 2007)
Róisín Murphy: „Overpowered“ (EMI 2007)
Dave Gahan: „Hourglass“ (EMI 2007)
PJ Harvey: „White Chalk“ (Island Records 2007)
Gravenhurst: „The Western Lands“ (Warp Records 2007)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik