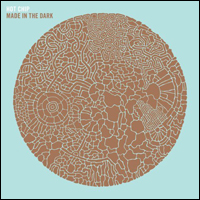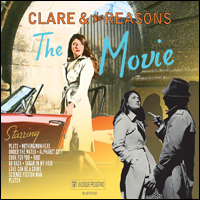Von Sirenen und Besoffenen, vom Verlieben und Verschmelzen, vom Nachtbus und dem Morgen nach der Party – davon singt Bishi. Die 24-jährige Musikerin lebt in London, als DJ hat sie sich in den Clubs der Stadt einen Namen gemacht. London sei ihr „pleasure ground, spectacular and cruel“, sagt sie. Ihre zweite Heimat ist Indien, von dort kommen ihre Eltern. Sie besucht das Land jedes Jahr.
Jetzt hat Bishi ihr erstes Album aufgenommen. Nights at the Circus heißt es, nach einem Roman von Angela Carter. Die Platte ist ein klingendes Panoptikum. Lustvoll und spielerisch verbindet Bishi die beiden Musikkulturen, in denen sie zuhause ist. Feinsinnige Elektronika trifft auf traditionelle indische Instrumente. Unermüdlich klopft sie die Tabla, die Sitar spielt sie wie eine E-Gitarre. Sie bereichert den Pop ihrer ersten Heimat um tausend kleine Klänge ihrer zweiten, verziert jedes Stück mit Glockenspiel, Ukelele und Harmonium. Über all dem schwebt ihre wandlungsfähige Stimme, teils zum Chor verstärkt. Das sei keine Weltmusik, sagt sie, sondern London-Musik.
In dem Lied The Swan entführt sie den Hörer in die Welt eines zarten Schwanenwesens und entgeht dem Kitsch um Haaresbreite; in Nightbus trottet man mit ihr bedrückt durch die Kälte, Nachtbusse sausen durch die von gebrochenen Kreaturen gesäumten Straßen; in der nächsten Nummer stürmt sie „on my own again“ wütend in Richtung Tanzboden.
Das Album schließt mit einem zauberhaften „Namaste“ – dem indischen Wort für Danke. Als habe sie das Geschenk empfangen, aus zwei Traditionen schöpfen zu dürfen und sich nicht zwischen ihnen zerreißen zu müssen. Der Trick sei, sagt sie, nicht zwischen den Kulturen zu wählen, sondern eine eigene zu erschaffen. Zur Zeit weilt Bishi in Buenos Aires, für den argentinischen Tango ist in ihrem großen Musikerinnen-Herzen allemal Platz.
„Nights At The Circus“ von Bishi ist bei Gryphon Records erschienen.
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie ELEKTRONIKA
Underworld: „Oblivion With Bells“ (PIAS 2007)
Camouflage: „Archive #1“ (Polydor 2007)
Raz Ohara And The Odd Orchestra: „s/t“ (Get Physical Music/Rough Trade 2008)
Closed Unruh: „Nichts schmeckt – aber alles schmeckt gut“ (E-Klageto 2007)
„A Number Of Small Things“ (Morr Music 2007)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik