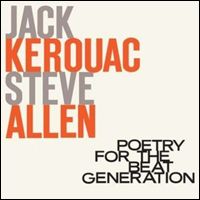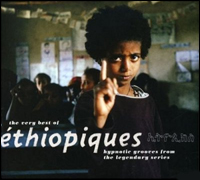Die erste Welle des Punk fegte zwischen den Jahren 1976 und 1978 über die britischen Inseln und veränderte die Musikwelt. Bereits Ende der Siebziger hatte sich die Bewegung zersplittert. Der Post-Punk entstand: The Clash ließen sich vom Reggae inspirieren, die Violent Femmes und die Young Marble Giants brachten die Energie des Punk auf akustischer Gitarre und Orgel zum Klingen, Elektronikbands wie Depeche Mode betonten die Künstlichkeit ihrer Musik. Joy Division und The Cure traten introvertiert auf, reduzierten das Tempo und experimentierten mit düsteren Klängen.
Die Band Bauhaus aus Northampton trieb in dieser Zeit das Düstere in die Finsternis und erfand den Gothic-Rock. Der Gitarrist Daniel Ash, der Schlagzeuger Kevin Haskins und sein Bruder, der Bassist David Haskins, gründeten die Band Mitte des Jahres 1979. Als Sänger engagierten sie den Drucker Peter Murphy, weil sie fanden, er sähe aus wie ein Musiker. Murphy hatte nie zuvor ein Stück oder einen Text geschrieben. Aber er hatte Talent und kaum sechs Wochen nach ihrer ersten Probe nahmen Bauhaus ihre erste Single auf.
Bela Lugosi’s Dead erschien im August 1979, das Stück dauerte düstere neun Minuten und bestand aus kaum mehr als einem simplen Gitarrenmuster, ein paar dumpfen Basstönen, sanftem Klacken des Schlagzeugs und Murphys Proklamation, der Schauspieler Bela Lugosi sei tot. Tot, tot, tot. Das Motiv war genial gewählt. Lugosis Namen verband man wie kaum einen anderen mit den Horror-Filmen der dreißiger Jahre, gestorben war er bereits lange zuvor. Ohne textlich und musikalisch auf die Pauke zu hauen, erzeugten Bauhaus durch die maßlose Repetition eine beklemmende Stimmung. Neun Minuten! Eine gute Punkband spielte in dieser Zeit ein halbes Album. John Peel präsentierte das Stück in seiner Show im britischen Radio, und er lud die Band sofort zu sich ins Studio ein. Noch im selben Jahr nahmen Bauhaus eine Session bei ihm auf.
Nach ein paar weiteren Singles erschien im Herbst 1980 das erste Album In The Flat Fields. Auf diesen ersten Aufnahmen wurden Bauhaus ihrem Namen durchaus gerecht. Die Klänge saßen an den richtigen Stellen, sie spielten keinen Ton zuviel. Bei aller Schwere besaßen sie immer auch Transparenz. Das Düstere entstand nicht durch Klangschichten, sondern durch den druckvollen Bass und Peter Murphys schneidende Stimme.
Drei weitere Studioalben entstanden, bis sich die Band im Jahr 1983 auflöste. Mask war dem ersten Album klanglich noch recht nah, Keyboards und mehrstimmiger Gesang nahmen den Stücken die beklemmende Kargheit. Die folgenden The Sky’s Gone Out und Burning From The Inside bestimmten noch deutlicher flächigere Klänge und poppige Melodien. Von der Magie der ersten Aufnahmen war am Ende nicht einmal Murphys Stimme geblieben, denn aufgrund einer Lungenentzündung war er am letzten Album kaum beteiligt. Erst fünfzehn Jahre später standen Bauhaus ein paar Konzerte lang erneut auf der Bühne. Sie spielten ein neues Stück, veröffentlichten das Live-Album Gotham und lösten sich wieder auf.
Vor zwei Jahren trafen sie sich und traten ein paar mal auf – unter anderem als Vorgruppe der Nine Inch Nails. Dann gingen sie ins Studio. Man habe sich sogar richtig gut verstanden, erzählte Kevin Haskins kürzlich, ein Zwischenfall habe ihnen aber gezeigt, dass sie nicht als Band weiterarbeiten sollten. Mehr verriet er nicht. So nahmen sie Go Away White noch fertig auf – und trennten sich wieder.
Die posthume Veröffentlichung ist zwiespältig. Der Bass tropft stet und tief wie damals, die Gitarre kreischt fast verhalten im Hintergrund. Peter Murphy kieckst und schnoddert, oft ist seine Stimme gedoppelt, oder es singen die Kollegen. Bei Adrenalin schreit er ein bisschen, dazu brezelt der Bass ganz gehörig. Die Lieder sind reduzierter, stellenweise fühlt man sich an Mask erinnert. Denn – und deswegen ist das Album auch eine Enttäuschung – an ihre erste Platte kommen Bauhaus auch nach so langer Zeit nicht mehr heran.
Es ist auffällig: Je weniger man hört, desto besser wird’s. Saved ist ruhig, stellenweise ist da nur Murphys Stimme, ab und an zersägt die Gitarre den leisen Klangteppich. Erst spät taucht ein Rhythmus auf, eine klare Basslinie und ein zaghaft angeticktes Schlagzeug. Adrenalin ist rockig aber klar, bei Mirror Remains gelingt es Bauhaus doch noch, Ruhe in Beklemmung zu verwandeln. So kann es gehen.
Die Melodien der anderen Stücke sind schon in Ordnung, aber wirklich überzeugend sind sie nicht. Viel zu oft fließen Keyboard-Klänge (Undone), Frauenchöre oder gar ein Honky-Tonk-Klavier (International Bulletproof Talent) in die Lücken, die In The Flat Fields noch ließ. Summer Of The Damned fröhnt dem ideenlosen Rock, in Black Stone Heart pfeift Peter Murphy zum elektrischen Klavier, später wird synthetisch geklatscht. So zerstören sie auch einige eigentlich gute Stücke.
Noch deutlicher ist ein technisches Problem: Moderne Studios machen es verlockend einfach, volle Klänge zu erzeugen. Go Away White klingt zu gut, um gut zu klingen. Die Klänge sind zu sauber, der dominante Bass ist perfekt ausgesteuert, die Gitarren reißen an keinem Lautsprecher mehr. Wo sind die Übersteuerungen? Wo ist das schlechtgelaunte Gerumpel? Alles nicht da. So ist Go Away White ein typisches Alterswerk: nicht gut, nicht schlecht, irgendwo zwischendrin und deshalb bald vergessen.
„Go Away White“ von Bauhaus ist bei Cooking Vinyl/Indigo erschienen.
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie ROCK
Nada Surf: „Lucky“ (City Slang 2008)
Alec Empire: „The Golden Foretaste Of Heaven“ (Eat Your Heart Out 2008)
Neil Young: „Dead Man“ (Vapor Records/Warner Music 1996)
Karate: „595“ (Southern Records 2007)
Nevada Tan: „Niemand hört dich“ (Vertigo/Universal 2007)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik