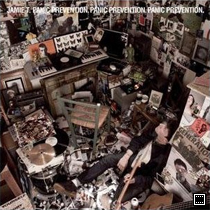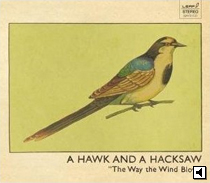„Du sagst, mein Lied hat keinen Sinn. Ich sage, doch – den, dass ich glücklich bin“, trällert Inga Humpe auf dem neuen Album von 2raumwohnung. Dazu kann man sehr gut den Frühjahrsputz machen.
Der Geschirrberg droht umzukippen, das Badezimmer wartet auf den Wischmob. Auf den Büchern liegt Staub, und die Gardinen gehören in die Waschmaschine. Keine Lust, sich um den Haushalt zu kümmern? Ein Fall für das neue Album von 2raumwohnung! Da kommt sie von ganz allein, die Leichtigkeit, mit deren Hilfe man freudig Fenster putzt und Kacheln und Töpfe reinigt. Inga Humpe und Thomas Eckarts neue Lieder machen das Leben locker, wer würde da noch vor ein bisschen Hausputz zaudern?
Auf dem großartigen Debütalbum Kommt zusammen sang Frau Humpe noch „Immer wenn ich glücklich bin, dann weiß ich schon, es wird nicht für immer sein“. Tanzbare Perlen der Popmusik waren es, positive Lebenseinstellung und Melancholie genau richtig gemischt. Und ihr Gesang war wunderbar lässig. „Das Leben ist mal wieder hart. Komm, bleib weich“, war ihre Antwort auf die Verbissenheit der Gegenwart. Diese schlichten Zeilen aus dem Jahr 2001 bestechen. Das neue Album 36 Grad klingt dagegen, als habe das Berliner Duo ein paar Glückspillen zu viel geschluckt. Die Texte sind zahm und die Musik geschliffen. Wir hätten es wissen müssen, Peter Plate und Ulf Leo Sommer von Rosenstolz haben am Album mitgearbeitet, das erhöht den Weichspül-Faktor.
Inga Humpe und ihre Schwester waren einst die Neonbabies. 1979 schufen sie mit dem Lied Blaue Augen einen Klassiker der Neuen Deutschen Welle bzw. Punkmusik. Es folgten wütende Lieder. Über die Jahre jedoch scheint Inga Humpe gelassener geworden zu sein. Heute ist sie 51 Jahre alt, genießt ihr Leben und bastelt mit Thomas Eckart zu Hause am Elektropop. „Wir müssen uns 2raumwohnung als glückliche Menschen vorstellen“, schreibt Thomas Winkler in der tageszeitung. Ja, das müssen wir wohl. Das wirkliche Leben kann draußen bleiben, ernste Themen finden hier nicht statt. Müssen sie ja auch nicht, alles eine Frage der Einstellung. „Du sagst, mein Lied hat keinen Sinn. Ich sage, doch – den, dass ich glücklich bin“, singt sie im Stück La La La. Es sei den beiden gegönnt, immerhin helfen sie uns beim Hausputz. Und wenn wir den schaffen, dann schaffen wir auch alles andere.
„36 Grad“ von 2raumwohnung ist als CD und Doppel-LP erschienen bei it sounds/Labels/EMI
Hören Sie hier ![]() „Besser gehts nicht“
„Besser gehts nicht“
2raumwohnung sind im März 2007 auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie ELEKTRONIKA
Diverse: „Girl Monster“ (Chicks On Speed Records 2006)
Diverse: „4 Women No Cry“ (Monika 2006)
DAF: „Alles ist gut“ (EMI 1981)
Four Tet: „DJ Kicks“ (!K7 2006)
Saroos: „s/t“ (Alien Transistor 2006)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter