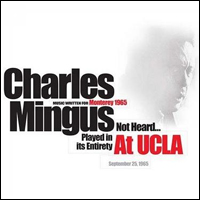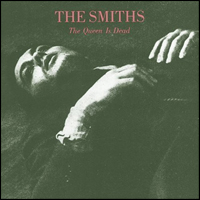Vor zwei Jahren erschien das Debütalbum Stars Of CCTV von Hard-Fi. Frecher britischer Rock steckte in den elf Liedern und eine gehörige Portion Dub, mehrstimmiger Gesang machte die meisten Stücke zu Hymnen. Vor allem die Singles Hard To Beat und Cash Machine glänzten. Es war auch manch Füllsel auf dem Album, aber das fiel kaum auf. Sechs Stücke von Stars Of CCTV wurden in Großbritannien als Single veröffentlicht. Den Dub kehrten Hard-Fi im vergangenen Jahr auf der Remix-Platte In Operation noch deutlicher heraus, daneben erschien eine Live-DVD. Bei soviel Mehrfachverwertung konnte die Band sich Zeit lassen mit dem zweiten Album.
Vielleicht hatten sie zuviel Zeit für Once Upon A Time In The West. Die Platte kann die Versprechen der ersten nicht halten. Sie klingt bemüht, stellenweise dünn. Wo sind die luftigen Melodien hin? Der Sänger Richard Archer gibt sich größte Mühe, seine Worte so lässig anzubringen wie vor zwei Jahren. Leider hört man das. Die Strophen klingen oft noch ganz gut, aber die Refrains verhaut er fast immer. I Close My Eyes rumpelt hymnisch aber ideenlos, der Sänger kämpft. Schließlich ist da eine Melodie, doch – oh, weh – was für eine!
Die mehrstimmigen Gesänge, die das erste Album so charmant machten, sind jetzt nervtötend. Sie wirken wie leere Hülsen für fehlende Worte und fehlende Ideen. „Heeeeeeee, Hoooooooo, Haaaaaaaa, Heeeeeee“ schmettert es in Suburban Knights, „Ooooooo, Aaaaaaa, Eeeeeeee“ in Tonight, „Uuuuuuu, Uuuuuuuu“ in Watch Me Fall Apart. Da wirkt das „Na na na na na na, na na na na na na“ in I Close My Eyes schon wie eine originelle Variation.
Auch musikalisch ist das Album flach. Zu oft drängeln sich rockige Gitarren in den Vordergrund, der Dub ist ganz verschwunden. Akustische Gitarren werden mit Schlagzeugcomputer und weichgespülten Refrains der Marke „Help me please, I’m in need“ kombiniert – „pliiihihihiiis“ mit ganz lang gezogenen Vokalen. Andere Stücke gehen in synthetischer Orchestersoße unter. Es dauert ein bisschen, bis man den Schock des ersten Hörens überwunden hat.
Beim zweiten Durchlauf macht die Platte an einigen Stellen sogar Spaß. We Need Love ist ein feines Stück, einfach und funktional. Richard Archer singt: „In Liverpool, in Glasgow und in London, was wir jetzt brauchen, ist Liebe.“ In Washington und San Salvador übrigens auch. Und am Ende johlen alle: „Whoooooa, whooooa.“ In Can’t Get Along klingen ein Ska-Rhythmus und Bläser durch, das ist sehr kraftvoll. Television fängt gut an, da sind Tanzrhythmen zu hören. Im Refrain bricht das Stück auseinander, es wird rockig und platt. „Television, new religion, let everyone sing Hallelujah. Politicians, don’t wanna listen, they only wanna make money out of you. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!“ Uff. So ist das überall, jede gute Idee wird früher oder später zugekleistert.
Die an Oasis erinnernde Melodie des letzten Stücks The King mag man gar nicht mehr so recht genießen. Im Hintergrund dröppelt ein künstliches Schlagzeug, darüber schmiegt sich eine Pudding-Schicht aus Geigengesäusel und Akustikgitarre. Zu allem Überfluss brezeln unsägliche Gitarren hinein. The King ist so zerfahren wie das gesamte Album.
Auf der sonnengelben Hülle steht in weißen Lettern „No Cover Art“. Die erste Single Suburban Knights ist ähnlich aufgemacht, „Expensive Black & White Photo of Band. Not Available“. Wenn die Lieder von Hard-Fi nur immer noch so gut wären wie ihre Witze.
„Once Upon A Time In The West“ von Hard-Fi ist als CD bei Warner Music erschienen.
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie POP
The Smiths: „The Queen Is Dead“ (Sire/Warner Music 1986)
Regina Spector: „Begin To Hope“ (Warner Music 2006)
Architecture In Helsinki: „Places Like This“ (V2 Records 2007)
The Sea & Cake: „Everybody“ (Thrill Jockey 2007)
MUS: „La Vida“ (Green Ufos/Hausmusik 2007)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter zeit.de/musik