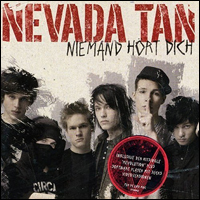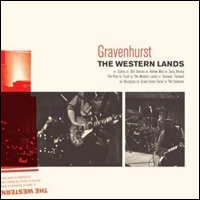Über die Jahre (27): Er verfluchte die großen Gangster und ergriff Partei für die kleinen Dealer. Auf „Back To The World“ zeichnete Curtis Mayfield im Jahr 1973 ein Bild von Amerika.

Das Siebdruck-Cover von Curtis Mayfields fünftem Soloalbum Back To The World zeigt Kampfjets, Industrielandschaften, obdachlose Schwarze, flamboyante Zuhälter, verarmte Kinder und Ratten in der Falle. Es ist das Jahr 1973, die Hoffnungen der Bürgerrechtsbewegung haben sich zerschlagen.
Legt man die Platte auf, hört man zunächst ein Flugzeug starten. Der Turbinenklang und ein pulsierender Bass verheißen Aufbruch. Das Titelstück entpuppt sich als das Klagelied eines Kriegsheimkehrers. Er hat keine Arbeit und findet sich nicht mehr zurecht. Der Krieg war lang und hart, seine Mutter ist sogar der Meinung, man hätte ihn verloren. Als Schwarzer im weißen Amerika muss man weiterhin vorsichtig sein, wohin man seinen Fuß setzt und wie man sein Haar trägt. Die neben Smokey Robinson süßeste Stimme des Soul trägt diese herzzerreißende Geschichte vor, im Hintergrund wirbeln Streicher, Bläser und ein unwiderstehlicher Groove.
Die nächste Nummer Future Shock ist ein fordernder Funk mit zackigen Bläsersätzen, unablässig klackernden Congas, pointierten Snare-Schlägen und Mayfields Wah-Wah-Gitarre. Dieser Sound war im Jahr zuvor durch seine Musik zu Super Fly zu einem Markenzeichen der Blaxploitation-Filme geworden. „Our wordly figures / Playin’ on niggers / Oh see them dancin’ / See how they’re dancin’ to the superfly / Ooh, ain’t it dumb / When you don’t know where we’re comin’ from“, distanziert sich Mayfield von der Verherrlichung des Lebens als Gangster. Einen Atemzug später fordert er Verständnis für die Drogendealer: „The price of the meat / Higher than the dope in the street / Is it any wonder / For those with nothing to eat.“ Eine Lösung ist aber auch der Drogenhandel natürlich nicht, „Son’s got it made / But still seems so afraid / There’s no love for his brother / No plans for another.“
In Right On For The Darkness konfrontiert ein Blinder die Wohlhabenden mit ihrer Ignoranz: „Your petty evils don’t bother me.“ Streicher überwältigen das Stück gegen Ende, sie sprechen eine andere Sprache. „We’re a hell of a nation / Right on for the darkness.“ Die erste Seite der Platte endet auf einer dunklen Note.
Seite 2 versucht einen illusorischen Neuanfang. „If I were only a child again / No one’s ever been so good to me since then / Everywhere I looked / It seemed so colour bright.“ Das Stück ist kurz und fröhlich, die Bläser jubilieren, schwungvolles Händeklatschen treibt es voran. Natürlich waren wir als Kinder nur zu jung, um die „Unsightly scars of death and war“ zu erkennen. Can’t Say Nothing ist ein Tribut an den psychedelischen Funk, den Norman Whitfield für die Temptations und Undisputed Truth entwarf. Weitgehend instrumental rockt das Stück über die Tanzfläche, das Orgel-Zwischenspiel deutet an, dass es weiter bergab gehen kann. Keep On Trippin’ nimmt den Hörer mit auf eine drogenfreie Reise. Es ist das heiterste Stück des Albums, leichtfüßig der Rhythmus, süß die Flöten, bittersüß die Streicher. Es ist ein Liebeslied, das Heilung verheißt. Sie hat ihn zwar verlassen, aber er glaubt an ihre Liebe und daran, dass sie zurückkommt.
Zum Schluss schickt Curtis Mayfield uns mit dem optimistischen Future Song in den Gottesdienst. „Heavenly Father“, singt er immer wieder, „I’ve got to testify“. Es ist eine dieser Soul-Nummern, in der sich die säkuläre Lust des Soul und die spirituelle Liebe des Gospel untrennbar verschränken. Die Orgel klingt, als würde sie in der Kirche stehen, gesungen wird an einem heimeligen Ort. Das Stück verheißt allumfassende Liebe, die mehr ist als Fleischeslust, „Take care a good woman / Take care a good man“. Das klingt naiv, doch da sind diese dunklen Untertöne. Immer wieder konterkariert Curtis Mayfield seine Vision brüderlicher Liebe. Auf seinem ersten Solo-Album Curtis sang er: „Niggas, whiteys, jews / If there’s a hell below / We’re all gonna go“. Wenn einem die Streicher und der süße Gesang auch den Himmel versprechen, es gibt immer eine Orgel oder Curtis Mayfields markante Gitarre, die einen an die Hölle auf Erden erinnern.
„Back To The World“ von Curtis Mayfield ist im Jahr 1973 bei Curtom/Warner erschienen.
…
Alle Beiträge aus der Serie ÜBER DIE JAHRE
(26) Codeine: „The White Birch“ (1994)
(25) The Smiths: „The Queen Is Dead“ (1986)
(24) Young Marble Giants: „Colossal Youth“ (1980)
(23) Sister Sledge: „We Are Family“ (1979)
(22) Rechenzentrum: „The John Peel Session“ (2001)
(21) Sonic Youth: „Goo“ (1990)
(20) Flanger: „Spirituals“ (2005)
(19) DAF: „Alles ist gut“ (1981)
(18) Gorilla Biscuits: „Start Today“ (1989)
(17) ABC: „The Lexicon Of Love“ (1982)
(16) Funny van Dannen: „Uruguay“ (1999)
(15) The Cure: „The Head On The Door“ (1985)
(14) Can: „Tago Mago“ (1971)
(13) Nico: „Chelsea Girl“ (1968)
(12) Byrds: „Sweetheart Of The Rodeo“ (1968)
(11) Sender Freie Rakete: „Keine gute Frau“ (2005)
(10) Herbie Hancock: „Sextant“ (1973)
(9) Depeche Mode: „Violator“ (1990)
(8) Stevie Wonder: „Music Of My Mind“ (1972)
(7) Tim Hardin: „1“ (1966)
(6) Cpt. Kirk &.: „Reformhölle“ (1992)
(5) Chico Buarque: „Construção“ (1971)
(4) The Mothers of Invention: „Absolutely Free“ (1967)
(3) Soweto Kinch: „Conversations With The Unseen“ (2003)
(2) Syd Barrett: „The Madcap Laughs“ (1970)
(1) Fehlfarben: „Monarchie und Alltag“ (1980)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik