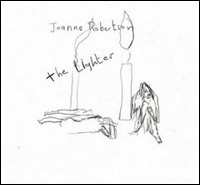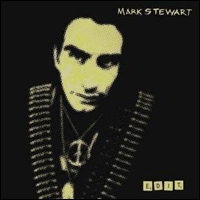Erste Station:
Gospel-Klatschen. Die Band macht es vor und wir beeilen uns mitzukommen. Dabei ist alles so entspannt. Ein leichtes Klagen, ein weiches Wünschen, warum sollte der Sonnenschein nicht auch uns begrüßen. Und dann passiert es.
Zweite Station.
Wir dürfen unsere Saiteninstrumente auspacken. Das Mädchen mit der Ukulele legt los, wird bald vom Banjo übertönt, gemeinsam erklimmen wir den Gipfel. „Wait For The Summer“, singen wir und warten. Dann wechselt das Tempo und der innere Puls schlägt leichter, schneller, passt sich dem Fluss des Gesangs und des schwingenden Tambourins an und einer nach dem anderen geht einfach, wenn es ihm passt zur
Dritten Station.
Wir haben unsere Raumanzüge mitgebracht, heben aber nicht ab. 2080 ist so weit weg, wir bleiben in der Gegenwart. Der Basslauf und ein gerades Schlagzeug nehmen uns mit auf einen Ritt, bis uns irgendwann doch noch die Schwärze der Popmelancholie umfängt.
Vierte Station.
Nach einem kollektiven Niesanfall sind wir froh, die glänzenden Anzüge noch nicht ausgezogen zu haben. Eifrig machen wir uns an die Arbeit und jonglieren mit Reagenzgläsern und Akkordeons, wir entdecken das Heilmittel und nehmen es nicht.
Fünfte Station.
Ein kurzes „Ah“ bringt uns in die kalifornische Gospelgemeinde Beach Valley. Aus einer Riesen-Zymbal und feinem afrikanischen Sand müssen wir eine indianische Moschee bauen, das ist uns ein Leichtes. Als wir fast fertig sind, schlendert ein Bluesgitarrist um die Ecke, wir begleiten ihn auf Mamas Juwelen.
Sechste Station.
Eine Übung für unser Inneres. Wie schnell vergeht der Ärger, wenn man zuhört. Welch ein erhabener Moment.
Siebte Station.
In mongolischen Fellen stapfen wir durch den Frost, beschwören das Monster der Rock-Steppe und wagen einen Abstecher ins Okkulte. Wie bei 1, 2 oder 3 hüpfen wir von einem Fass auf das nächste und wundern uns, dass am Ende alle Antworten richtig sind.
Achte Station.
Wir sind erleichtert, dass jetzt moderate Waikiki-Hüftschwünge angesagt sind. Wir drehen uns so lange im Kreis, bis uns schwindelig wird, und stolpern zur
Neunten Station.
Im Erdreich ist es dunkel, wir bauen uns eine Wurm-Pyramide.
Zehnte Station.
Wir entfliehen der Düsternis und landen in der roten Höhle. Wir sammeln die umherliegenden Instrumente ein, klettern aus unseren von Sand und Lehm beschmutzten Raumanzügen und suchen Holz für ein Lagerfeuer. Und weil da ein Wald ist, wird es ein großes Feuer. Und weil das nicht reicht, tanzen wir. Und weil das auch noch nicht genug ist, sind wir einfach froh, zu sein, wo wir sind.
Auf dem Heimweg freuen wir uns, wie großartig doch ein bisschen Sport sein kann.
„All Hour Cymbals“ von Yeasayer ist bei We Are Free/Cargo Records erschienen.
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie POP
Portishead: „Third“ (Island/Universal 2008)
Gnarls Barkley: „The Odd Couple“ (Warner 2008)
Taunus: „Harriet“ (Ahornfelder 2008)
Billy Bragg: „Mr. Love & Justice“ (Cooking Vinyl 2008)
Adele: „s/t“ (XL Recordings/Beggars Banquet 2008)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik