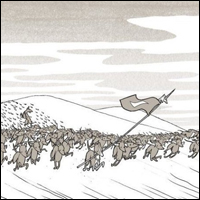Es dröhnt aus dem Orchestergraben, satte zweieinhalb Minuten lang werden die Instrumente gestimmt. Der Dirigent schlägt ein paarmal auf sein Pult, er mag den Rhythmus. Die Tasteninstrumente werden lauter, bald schreien sie in den höchsten Tönen. Nach fünf Minuten tritt die Basstrommel auf, kurz darauf ruft jemand unverständliche Worte. Nach sieben Minuten ist aus dem Stimmen der Instrumente ein Inferno geworden. Die Pauken werden gedroschen, dem Vokalisten droht die Heiserkeit. Eine Gitarre beginnt kleine Muster in die Klangmauer zu meißeln, hier und dort bricht auch eines der Keyboards aus der Repetition aus und entwirft eine süße Melodie. Neun Minuten sind vorüber.
Zwei weitere Minuten vergehen, die Gitarren schwingen sich in metallische Höhen. Sie quietschen und jaulen, als wären Iron Maiden oder Judas Priest am Werk. Der Sänger gibt’s auf, er röchelt noch leise im Hintergrund. Nach und nach verschwinden der Lärm, verstummen die Instrumente, sogar das Klöppeln des Taktstocks. Am Ende bleibt nur ein flauschiger Teppich aus Keyboardsäuseln, eine Minute lang liegt er da zur Erholung.
Von Minute dreizehn an kommen die Musiker aus der Pause zurück. Erst die Keyboards, sie sind jetzt melodiöser. Dann ein nervöses Pluckern, stammt das von einer Gitarre? Und ein sirenenartiges Geräusch. Nach fünfzehneinhalb Minuten setzt ein geradliniges Schlagzeug ein, auch der Sänger hat sich erholt und erzählt, in den Siebzigern geboren worden zu sein: Er suche nach Schönheit. Plötzlich wird aus dem wilden Lärmen ein richtiges Lied. Es klingt nach dem New Wave der frühen achtziger Jahre, elektronisch und treibend. Es bleibt aber verspielt, hier wird ein Chor gesampelt, dort scheint jemand im Hintergrund zu husten, hier heult eine Sirene, dort stimmt das Orchester die Instrumente aufs Neue. Nach weiteren vier Minuten wird sehr langsam ausgeblendet.
Xaxapoya heißt dieses Monstrum, es ist zweiundzwanzig Minuten lang. Es ist das erste Stück – oder die erste Seite – des neuen Albums der deutschen Band Von Spar. Das zweite Stück – oder die Rückseite – heißt Dead Voices In The Temple Of Error und dauert achtzehn Minuten. Mit Die uneingeschränkte Freiheit der privaten Initiative waren Von Spar vor einigen Jahren überaus erfolgreich. In Stücken, die so ähnlich klangen wie die letzten vier Minuten von Xaxapoya, brachten sie ihre Energie auf den Punkt. Ihre Texte waren deutsch und politisch, das hektische Organ von Thomas Mahmoud das Markenzeichen ihrer Musik.
Auch beim zweiten Stück Dead Voices In The Temple Of Error nehmen sich Von Spar Zeit, lassen sich von einer Idee zur nächsten treiben, von einem Genre ins andere. Sie beginnen mit einer Mischung aus Hörspiel und knisternder Elektronika (Minute 1 bis 4), schwingen sich dann langsam ein (Minute 4 bis 7), wandern durch die siebziger Jahre (Minute 7 bis 12 ) und den Death-Metal (Minute 12 bis 15) hin zu nervösen Klangexperimenten, die an Mike Patton erinnern (Minute 15 bis 18).
Was hat sie wohl bewogen, eine solche Platte aufzunehmen? Sie ist ausufernd und uneindeutig. Der Sänger hat kaum etwas zu singen. Ist es der Versuch, Erwartungen zu unterlaufen? Der Ausdruck gelebten Künstlertums?
Schwer zu sagen. Aber interessant ist das.
„Xaxapoya/Dead Voices In The Temple Of Error“ von der Band Von Spar ist als LP und CD erschienen bei Tomlab
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie ROCK
Tocotronic: „Kapitulation“ (Universal 2007)
Shellac: „Excellent Italian Greyhound“ (Touch & Go/Soulfood Music 2007)
Editors: „An End Has A Start“ (PIAS/Rough Trade 2007)
Tomahawk: „Anonymous“ (Ipecac 2007)
Battles: „Mirrored“ (Warp/Rough Trade 2007)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik