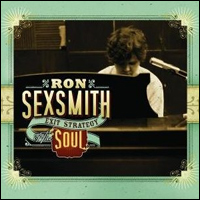Über die Jahre (39): Der Kölner Wolfgang Voigt verarbeitete Mitte der Neunziger seine Kindheit in dem Projekt GAS. Unter dem Titel »Nah und Fern« werden die vier Alben aus dieser Zeit nun wieder aufgelegt.
Im Rückspiegel erscheint es, Wolfgang Voigt habe einen großen Plan verfolgt. Im Jahr 1996 veröffentlichte er kurz hintereinander zwei tabubrechende Platten: Zuerst die Maxi Polka Trax, eine Mischung aus Minimal-Techno und Polka-Rhythmen, dann die erste CD seines Ambient-Projekts GAS. Die Hülle schmückten unauffällige, abstrakte, gelbe Farbflächen, die Platte hatte es in sich. Die Lieder trugen keine Namen, auch später nicht.
In den beiden Folgejahren erschienen weitere Aufnahmen von GAS mit den vielsagenden Titeln Zauberberg und Königsforst. Bäume schienen es Wolfgang Voigt angetan zu haben: Zauberberg steckte hinter einer blutrot schimmernden Detailaufnahme eines Waldes, Königsforst hinter in warmes Orange gehüllten Zweigen. Da hatte sich längst herumgesprochen, dass der von einem sturen Bassrhythmus begleitete nebulöse Ambient der drei Alben auf Schnipseln von Richard Wagner, Gustav Mahler und Alban Berg beruhte.
Wolfgang Voigt teilte damals mit, er beabsichtige die Erfindung genuin deutscher Popmusik. Da runzelte sich manche Stirn: Ein Projekt namens GAS, ein Label namens BLEI – geschrieben in altdeutschen Lettern, Klangfetzen Wagners, und das alles zusammen soll das reine Deutsche repräsentieren? War Wolfgang Voigt der Anselm Kiefer des Techno?
Dass die Lieder von GAS auf Schnipseln der Musik Wagners, Bergs und Mahlers aufbauen, muss man wissen. Hören kann man es nämlich kaum. Voigt verwendete unauffällige Passagen aus ihren Werken und schnitt sie so klein, dass man sie kaum wiedererkennt. Das vierte Stück auf Zauberberg basiert zwar auf einem prägnanten Sample, wirklich zuordnen kann man es aber nicht. Voigt scheint einen kurzen, im Gesamtwerk unauffälligen Übergang zur tragenden Stütze seines Stücks umfunktioniert zu haben. Die genaue Bestimmung des verwendeten Materials ist so unmöglich, wie der Versuch aus der Detailaufnahme des Zweigs auf der Hülle von Königsforst auf den Wald zu schließen, in dem das Foto geschossen wurde.
Vor seinen Aufnahmen als GAS hatte Voigt noch anders gearbeitet. Unter dem Namen Love Inc. erschien im Jahr 1995 das Album Life’s A Gas, die gesampleten Platten von Kraftwerk, Hot Chocolate, Miles Davis, Scritti Politti, Marc Bolan und anderen waren auf der Hülle der Platte abgebildet. Mit etwas Mühe ließ sich das verwendete Material auch heraushören. Mit GAS verabschiedete sich Voigt vorerst von solchem Zitatpop. Von nun an ging es ihm nicht mehr darum, Markierungen zu setzen, über die man ihn und seine Welt definierte. Vielmehr begann er, das Unbewusste zu verarbeiten, all das Gerümpel der Kindheit, das Unverdaute und Nicht-Begriffene. Wolfgang Voigt erzählte in Interviews von Wanderungen mit seinen Eltern in den Alpen, die er genossen habe. Er erzählte vom Schlager, der im Hause seiner Eltern lief und die Musik seiner Kindheit wurde. Auch die radikale Rebellion der Pubertät befreite ihn nicht von diesen Eindrücken.
So zog er sich zurück. In den deutschen Wald, den er mochte, dessen ideologische Bedeutung er aber verabscheute. Hier konnte er alles verarbeiten, den belächelten Schlager, sein schwieriges Verhältnis zur Klassik – den Drang, Mahler zu genießen und sich gleichwohl vom Habitus der Klassik zu distanzieren. So entstanden Polka-Techno, Stücke mit Schlagersamples und eben das Magnum Opus Voigts, GAS. Um den Missverständnissen entgegenzutreten, nannte er die vierte und letzte GAS-Platte im Jahr 2000 Pop. Der Nebel lichtete sich, die Strukturen wurden erkennbar. Mit einer Ausnahme schweigt die Basstrommel auf dieser CD. Hier deutete sich bereits Voigts nächstes Projekt an, nicht weniger als die Erfindung eines neuen Genres: Pop Ambient.
Um die demokratisierende Kraft des Pop ging es Voigt immer. Die musikalischen Nebelschwaden auf den Platten von GAS sind flüchtig, nicht monumental. Die aufgerufene Geschichte wird in abstrakte Einheiten zerlegt und in eine scheinbar endlose Schleife gelegt. Ihr schwerer Sinn verflüchtigt sich so. Das GAS ist nicht Zyklon B, sondern Musik. Und BLEI eine spielerische Reminiszenz an die bleischwere Vergangenheit, die man nicht vergessen kann und nicht vergessen will. Die aber auch nicht zu monumentalen Schinken aufgeblasen werden sollte. Mit Anselm Kiefer hatte GAS wahrlich nichts zu tun.
Mit dem Abstand einer Dekade hört man heute, wie schlau das Oeuvre von GAS angelegt ist, wie geschickt Voigt Parodie und Pathos umschifft. Welcher Geschichtsrevisionist soll sich das mit Genuss anhören? Wie sollte man auf diesem wabernden Fundament ein Walhalla erbauen? Und was ist aus der Idee »genuin deutscher Popmusik« geworden? Heute gibt es einen Minimal-Techno deutscher Prägung. Die Grundlagen dafür legte Wolfgang Voigt zur gleichen Zeit unter dem Pseudonym Studio 1, mit klassik- und folklorefreien Stücken, die auf den Rhythmus reduziert sind.
»Nah und Fern« von Gas ist auf 4 CDs bei Kompakt/Rough Trade erschienen. Ebenda wurde eine Doppel-LP mit Ausschnitten der Werke veröffentlicht.
…
Weitere Beiträge aus der Serie ÜBER DIE JAHRE
(38) Liquid Liquid: »Slip In And Out Of Phenomenon« (2008)
(37) Nick Drake: „Fruit Tree“ (1979)
(36) The Sonics: „Here Are The Sonics!!!“ (1965)
(35) dEUS: „In A Bar, Under The Sea“ (1996)
(34) Miles Davis: „On The Corner“ (1972)
Hier finden Sie eine Liste aller in der Serie erschienenen Beiträge.
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik