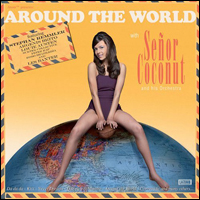Munk macht Tanzmusik von morbider Schönheit. In seinen besten Momenten klingt das Album »Cloudbuster« nach italienischer Nobeldisko und dem New Yorker Punkschuppen CBGB.

»Come on, bring it on!«, flüstert eine Stimme zu Beginn. Das ist mehr als eine Aufforderung, das klingt wie ein Befehl. Ein massiger Klavierakkord springt die Tonleiter hinauf, erinnert an die besten Zeiten der Housemusik. Die Flüsterstimme ist wieder da. Diesmal verkündet sie: »Live Fast! Die Old!«. Müsste das nicht ganz anders heißen? Was ist geschehen mit dem selbstzerstörerischen Credo des Rock’n’Roll? Hier werden noch ganz andere Sachen passieren. Willkommen auf Cloudbuster, dem musikalischen Spiegelkabinett von Munk.
Munk waren mal zu zweit. Jonas Imbery und Mathias Modica krempelten mit ihrem Debütalbum Aperetivo vor drei Jahren die elektronische Tanzmusik um. Bei ihnen trafen Post-Punk, Synthesizer-Disco und Wave aufeinander. Als eine der ersten deutschen Bands verbanden Munk die Do It Yourself-Ästhetik des Punk mit dem Disco-Glitzern ihrer Wahlheimat München. Dort stand einmal die Wiege des berüchtigten Munich Sound: Giorgio Moroder schoss von hier aus seine galaktischen Disco-Weltraumabenteuer in die Erdumlaufbahn.
Mit Gomma Records erfanden Imbery und Modica im Jahr 2004 auch gleich das Label zum Klang. Dabei ist Gomma weniger eine Plattenfirma als vielmehr ein Design. Neben elektronischer Musik erscheint hier mit dem Amore Magazine eine Plakatzeitschrift. Befreundete Künstler und Modedesigner gestalten die eigene T-Shirt-Kollektion und kümmern sich um den optischen Gesamtauftritt der Firma. Zu Modeschauen von Louis Vuitton und Givenchy steuern Künstler des Labels die Begleitmusik bei. Gommas Konzept funktioniert in Galerien und Clubs gleichermaßen. Inmitten des Irrsinns fanden Imbery und Modica immer noch Zeit, als DJ-Team aufzutreten. Mittlerweile betreibt Mathias Modica das Projekt Munk allein. Jonas Imbery produziert unter dem Namen Telonious eigene Musik.
Cloudbuster ist eine Tanzplatte von morbider Schönheit geworden. Schon die Single Live Fast! Die Old! macht deutlich, dass Munk die Punk-Attitüde des Vorgängeralbums gegen den schillernden Pathos des Disco eingetauscht haben. Schwere Akkorde des ausgebildeten Klavierspielers Modica zitieren die Klassiker des Chicago House. Eine laszive Frauenstimme singt dazu mal auf Englisch, mal auf Italienisch. Sie gehört der Schauspielerin Asia Argento, der Tochter des italienischen Horror-Regisseurs Dario Argento. Sie verleiht den Stücken eine düstere Erotik.
In seinen besten Momenten klingt Cloudbuster nach italienischer Nobeldisko und dem Punkschuppen CBGB zugleich. Immer wieder verweisen die Lieder auf die kruden Anfänge der Diskomusik, den Hang zur verschwenderischen Melodie leiht sich Modica bei der Italo Disco, die Orgeln und Schlagzeugeffekte klingen nach frühen Krautrockexperimenten.
Den Bass hält Modica erstaunlich flach, richtig abheben will keines der Stücke. Cloudbuster ist keine reine Clubplatte, es gibt zu viel zu entdecken. Es ist eine Platte voller popmusikalischer Kalauer, die mit Klugheit und Charme angeschoben werden. Hier bemüht Modica alberne Soundeffekte, dort darf Asia Argento »I don’t like milk, I don’t like lemonade« über eine brummende Basslinie rappen. Die Ernsthaftigkeit, mit der sie das tut, gibt No Milk etwas Absurdes. So ist die erste Hälfte des Albums überaus unterhaltsam, ein Hit jagt den nächsten. Das schunkelige The Rat Race und der lässige Groove auf You Never See Me Back Down gehören zu den Höhepunkten.
Irgendwann jedoch kippt die Stimmung. Seltsame Geräusche schleichen sich ein, die Stücke haben keine klar erkennbare Struktur mehr. Die Rhythmen schleppen sich wie lahme Monster vorüber, rätselhaft verzerrte Stimmen dringen an die Oberfläche. Direkt unheimlich klingt Cloudbuster in der zweiten Hälfte, die gute Laune ist verschwunden. Ist das überhaupt noch Disco-Musik? Tanzen möchte man dazu jedenfalls nicht.
Was zunächst als Bruch verstört, offenbart sich beim näheren Hinhören als logischer Übergang. Die Platte gewinnt nun an Atmosphäre, gleicht einer Filmmusik. Die poppige Breite der ersten Stücke weicht einer cineastischen Doppelbödigkeit. Hier zielt die Platte nur noch vordergründig auf den Tanzboden, der tatsächliche Spielraum ist das Kino im Kopf. Die vielen Verweise auf filmische Vorbilder sind gar nicht zu übersehen: Das starrende Auge auf der Plattenhülle erinnert an Luis Buñuels Stummfilm Ein andalusischer Hund, die musikalischen Themen auf Stücken wie Interludus #1 und Il Gatto könnten italienischen Giallo-Filmen entstammen. Der Titel des Stücks PsychoMagic verweist auf die dubiose Therapiemethode des Regisseurs und Tarot-Meisters Alejandro Jodorowsky. Und damit nicht genug: Den Text von The Rat Race schrieb der Filmemacher Klaus Lemke. In einem der Platte beiliegenden Pamphlet findet Lemke weise Wort: »Musik ist für die Gefühle da, die man woanders nicht unterkriegt.« Cloudbuster ist voll von diesen Gefühlen.
„Cloudbuster“ von Munk ist auf CD bei Gomma erschienen.
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie ELEKTRONIKA
Gustav: „Verlass die Stadt“ (Chicks On Speed Records 2008)
Mark Stewart: „Edit“ (Crippled Dick Hot Wax 2008)
Bishi: „Night At The Circus“ (Gryphon 2008)
Underworld: „Oblivion With Bells“ (PIAS 2007)
Camouflage: „Archive #1“ (Polydor 2007)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik